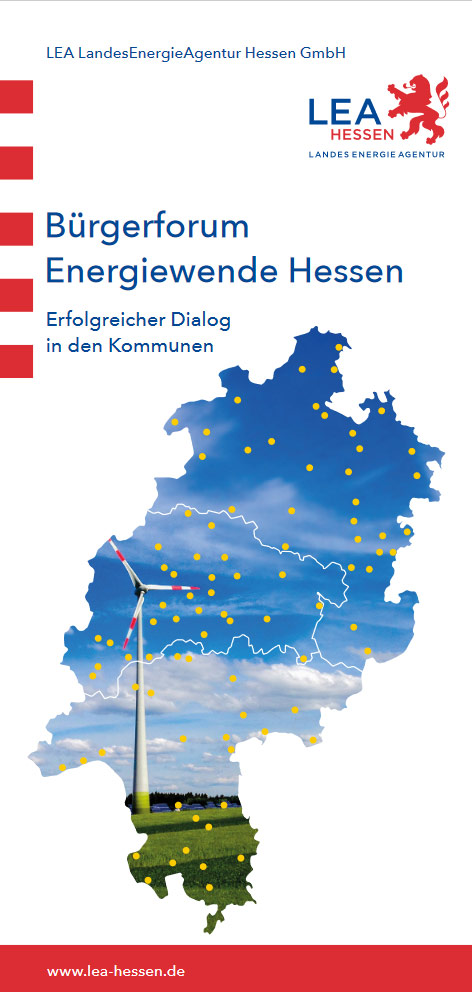Neuer Erklärfilm vermittelt Grundwissen zu Infraschall
Ein neuer Erklärfilm des Bürgerforums veranschaulicht die wichtigsten Fakten zum Thema Infraschall. Der Film geht unter anderem darauf ein, was Infraschall überhaupt ist, wo er vorkommt und warum der Infraschall von Windenergieanlagen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. Der knapp vier Minuten lange Film soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, sich in kurzer Zeit einen Überblick über das Thema zu verschaffen. Der Film beruht in weiten Teilen auf den Ergebnissen des Faktenchecks und Fakten-Updates des Bürgerforums zum Thema Infraschall.
Sie finden den Film in unserer Mediathek und auf YouTube.
Fakten-Update zu Infraschall erschienen
Seit dem viel beachteten Faktencheck des Bürgerforums im Jahr 2014 zu „Windenergie und Infraschall“ ist ein breites Spektrum an neuen Studien erschienen. Die Ergebnisse sind im neuen Fakten-Update zusammengefasst. Es wird wieder bestätigt, dass es kein Zusammenhang zwischen Infraschall und körperlichen oder psychischen Beschwerden besteht.
Mehr zum Fakten-Update und Thema Infraschall hier.
Download: Fakten-Update Windenergie und Infraschall
Update zum Faktenpapier Infraschall in Arbeit
Gesundheitliche Auswirkungen durch Infraschall aus Windenergieanlagen werden aktuell neu diskutiert. Kürzlich hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) eingestanden, sich in einer von Kritikern viel zitierten Studie aus dem Jahr 2005 verrechnet zu haben. Die veröffentlichten Schallwerte seien um 36 Dezibel zu hoch gewesen. Die BGR hat die offensichtlich falsche Studie jetzt aus dem Netz genommen und eine Überarbeitung angekündigt.
Beim Bürgerforum Energiewende Hessen der hessischen LandesEnergieAgentur (LEA) ist der Schutz vor (tieffrequenten) Schallimmissionen eines der prägenden Themen in den Debatten um den möglichen Bau von Windenergieanlagen. Seit dem viel beachteten Faktenklärungsprozess zum Thema Infraschall in den Jahren 2014-2015 sind neue Studien erschienen, welche die gesundheitlichen Auswirkungen des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls auf Mensch und Umwelt untersuchen. Die LEA bereitet daher derzeit eine Übersicht über aktuelle Studien und die zwischenzeitlichen Erkenntnisgewinne zu dem Thema vor. Mit dem Update wird der Anspruch erhoben, in der fachlichen Debatte immer auf der Höhe der Zeit zu sein und die Implikationen neuer technischer, wissenschaftlicher oder regulativer Entwicklungen für geplante oder bestehende Windenergieanlagen im Blick zu behalten.
Wieder Expertinnen und Experten eingebunden
Als Grundlage für das Update dienen sechs zentrale nationale und internationale Studien der letzten Jahre des Umweltbundesamtes 2020, der Universität Bayreuth 2020, vonMaijala et al. 2020, von Poulsen et al. 2018, von Vahl et al. 2018 sowie die TremAc-Studie 2020. In einem systematischen Review-Prozess wurden die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren sowie die am letzten Faktenpapier involvierten Personen gebeten, sich zu beteiligen. Viele haben daraufhin ihre Expertise in den Prozess eingebracht. Eine Zusammenfassung der Studien ging den Expertinnen und Experten zu, die jeweils anonyme Statements dazu verfasst und gegenseitig kommentiert haben. Die neuen Erkenntnisse werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.
Bestehende Publikationen zum Thema Schall und Infraschall von Windenergieanlangen
Aktuellle Debatten
Bensheim, 31.01.2019. Fragen zu hörbarem Schall, tieffrequentem Schall und Infraschall werden im Zusammenhang mit Windenergieanlagen immer wieder diskutiert: Richtlinien werden weiterentwickelt, Empfehlungen ausgesprochen und Forschung wird betrieben. Wie in den Jahren zuvor wird das BFEH auch 2019 die aktuellen Debatten aufgreifen und die wichtigsten Zusammenhänge von Schallimmissionen und Windenergieanlagen sorgsam unter die Lupe nehmen.
Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Schallimmissionen von Windenergieanlagen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Oktober 2018 neue Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region veröffentlicht. In dem Papier werden neben Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie Freizeitlärm erstmals auch Windenergieanlagen von der WHO als potentielle Lärmquelle betrachtet. Die WHO empfiehlt, Lärm durch Windenergie in der unmittelbaren Nähe von allgemeinen Wohngebieten tagsüber auf unter 45 Dezibel Lden zu reduzieren. Der Indexwert Lden („Tag-Abend-Nacht-Lärmindex“) beschreibt einen 24-Stunden Mittelwert für Schallemissionen. Laut der Leitlinien sollen die Emissionen also in dem gewichteten Tagesmittel nicht über 45 Dezibel liegen. Zur Einordnung: Flüstern hat etwa 30 Dezibel (dB(A)), bei leiser Radiomusik werden 50 dB(A) gemessen (Hinweis: der Schalldruckpegel wird in Dezibel (dB) gemessen, während die Belastung des Schallpegels für das Gehör in dB(A) angegeben wird). Für die nächtlichen Lärmwerte gibt die WHO keine spezifische Empfehlung.
Im Gegensatz zu den Empfehlungen für die anderen untersuchten Lärmquellen werden die Empfehlungen für Windenergieanlagen nicht als „stark“, sondern nur als „bedingt“ empfohlen eingestuft („conditional recommendation“). Die WHO hat in ihren Untersuchungen keine belastbaren wissenschaftlichen Studien ausgemacht, die gesundheitliche Schäden durch Lärm von Windenergieanlagen wie kardiovaskuläre Krankheiten, kognitive Störungen sowie Hörverlust, Tinnitus oder Schäden bei der Geburt belegen. Auch für Schlafstörungen bedingt durch Geräuschemissionen von Windenergieanlagen wurden keine statistisch signifikanten Belege gefunden. Den Grenzwert von 45 dB Lden leitet die WHO vor allem aus vier Studien zum Störempfinden von Bürgerinnen und Bürgern ab. Diese Studien legen nahe, dass sich ab 45 Dezibel mehr als 10 Prozent der Betroffenen von den Geräuschen „stark beeinträchtigt“ fühlen.
In Deutschland werden die Schallimmissionen von Windenergieanlagen von den zuständigen Immissionsschutzbehörden auf Grundlage der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)“ sowie dem begleitenden Regelwerk geprüft. Diese definiert als Richtwerte für Anlagen in allgemeinen Wohngebieten derzeit 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts.
Die WHO Leitlinien sollen gesetzgeberische und andere politische Entscheidungsprozesse auf der kommunalen, nationalen und internationalen Ebene unterstützen, sind aber für die EU-Staaten nicht bindend. Ob und wie die Empfehlungen in Deutschland durch die Politik umgesetzt werden, ist noch unklar.
Quellen und weiterführende Informationen
Zusammenfassung der WHO Leitlinien (Deutsch)
Ausführliche WHO Leitlinien (Englisch)
Artikel im Deutschen Ärzteblatt
Informationspapier des BWE - Schallimmissionen von Windenergieanlagen
Aktueller Stand zum Thema Infraschall
Im Dezember 2014 führte das BFEH den ersten Faktencheck zum Thema Infraschall durch. Das im Mai 2015 veröffentlichte Faktenpapier Infraschall stellt den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Infraschall dar. Die Entwicklungen in der Debatte rund um Infraschall und tieffrequenten Schall werden vom BFEH weiterhin kontinuierlich verfolgt. Ende 2018 befragte das BFEH verschiedene Expertinnen und Experten über neue Kenntnisse zur gesundheitlichen Auswirkung von Infraschall durch Windenergieanlagen. Den Befragten lagen zu diesem Zeitpunkt keine wesentlichen neuen bzw. eindeutigen Erkenntnisse zu Wirkungen von Infraschall auf den Menschen vor.
Auswertungen vorhandener nationaler und internationaler wissenschaftlicher Studien
Eine Veröffentlichung des Umweltbundesamtes von November 2016 zu möglichen gesundheitlichen Effekten von Windenergieanlagen bestätigt die Aussage des Faktenchecks, dass insgesamt keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über gesundheitliche Auswirkungen durch von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschall vorliegen.
Auch die im Auftrag des Schweizer Bundesamtes für Umwelt im Oktober 2017 erschienene wissenschaftliche Auswertung der vorhandenen Literatur zu gesundheitlichen Auswirkungen des Schalls von Windkraftanlagen, einschließlich tieffrequentem Schall und Infraschall, kommt zu dem Schluss, dass nach derzeitigem Stand der Wissenschaft kein Nachweis für gesundheitliche Effekte vorliegt, die durch Infraschall von Windenergieanlagen ausgelöst werden.
Quellen
Großangelegte Studie aus Dänemark
Im Dezember 2018 wurden die Ergebnisse einer groß angelegten dänischen Studie veröffentlicht. Diese untersuchte, ob Lärm von Windkraftanlagen (WEA) das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. In der Auswertung ließ sich kein Zusammenhang zwischen dem Lärm von WEA und der Einnahme von blutdrucksenkenden Medikamenten feststellen. Auch zwischen den von Windenergieanlagen ausgehenden Schallemissionen und dem Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko konnte kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden. Zwar deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems von tieffrequenten Schallimmissionen im Wohnbereich in der Nacht ausgelöst werden könnten, allerdings könnte das nach Aussage der Autoren auch dem Zufall geschuldet sein, da die Ergebnisse auf einer geringen Fallzahl basieren.
Quellen
Ergebnisse der Arbeitsgruppe Infraschall an der Universität Mainz
An der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Unimedizin Mainz untersuchte die Arbeitsgruppe Infraschall um Professor Christian-Friedrich Vahl in einem Experiment, ob und in wieweit Infraschall unter Laborbedingungen isoliertes Herzmuskelgewebe schädigt. Das im Januar 2018 veröffentlichte Ergebnis deutet darauf hin, dass im gegebenen experimentellen Umfeld Infraschall direkte Auswirkungen auf menschliches Herzmuskelgewebe hat. Die Veröffentlichung enthält jedoch keine konkreten Angaben dazu, inwieweit der unter Realbedingungen von Windenergieanlagen im Betrieb ausgehende Infraschalldruck solche gesundheitlichen Beeinträchtigungen hervorrufen kann.
Quelle
Folgestudie des Umweltbundesamtes
Ein Hauptaugenmerk des Faktenchecks zum Thema Infraschall galt damals der 2014 veröffentlichten „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall“ des Umweltbundesamtes. Die Mitautoren Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé (Universität Wuppertal) und Christian Eulitz (Möhler+Partner Ingenieure AG) waren auch am Faktencheck beteiligt. Derzeit begleiten beide Experten die laufende UBA-Studie „Lärmwirkungen von Infraschall-Immissionen“, die voraussichtlich im 1. Quartal 2020 veröffentlicht werden soll.
Sollten sich aus der Folgestudie des UBA wesentliche neue Erkenntnisse für die Debatte ergeben, wird das BFEH diese in einem Update des Faktenchecks Infraschall aufgreifen. In diesem Zusammenhang würden dann auch die übrigen Studienergebnisse noch einmal ausführlich durch die Expertinnen und Experten betrachtet und bewertet.
Überwachung von Schallimmissionen
Im Rahmen der BFEH-Tätigkeiten vor Ort kommen immer wieder Fragen und Unsicherheiten zur Überwachung von Windenergieanlagen (WEA) nach Genehmigungserteilung auf. Es wird kritisch hinterfragt, ob die Nebenbestimmungen in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und die gesetzlichen Betreiberpflichten bei der Errichtung, dem Betrieb und auch dem Rückbau der WEA tatsächlich eingehalten werden. Insbesondere Fragen zur Überwachung der vorgeschriebenen Richtwerte für Schallimmissionen stehen hierbei im Vordergrund. Die Einführung eines überarbeiteten Verfahrens zur Schallprognoseberechnung auf Grundlage neuer Hinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (sog. „LAI-Hinweise“) im November 2017 in Hessen verstärkte schließlich den Informationsbedarf.
Daher hat das BFEH diese Thematik aufgriffen und im Oktober 2018 die Kurzinformation „Windenergie in Hessen: Genauere Prognosen zum Schallimmissionsschutz durch Umsetzung der neuen LAI-Hinweise“ herausgegeben. Diese Kurzinformation gibt kompakte Antworten auf Fragen zu den neuen LAI-Hinweisen und den daraus resultierenden Änderungen in Hessen. Im Fokus steht dabei neben den Auswirkungen auf geplante WEA auch die Überprüfung bestehender Anlagen, welche durch einen Erlass der Hessischen Landesregierung vom 17. Mai 2018 geregelt wird.
Das BFEH wird im Jahr 2019 den Fachdialog mit Expertinnen und Experten zum Thema Überwachung von WEA insbesondere mit Blick auf Schallimmissionen weiterführen und intensivieren. Die praktische Umsetzung des Erlasses zur Überprüfung bestehender Anlagen in Hessen werden wir begleiten. Neue Erkenntnisse und wichtige Hinweise werden wir dabei zeitnah aufbereiten und publik machen.
Weiterführende Informationen